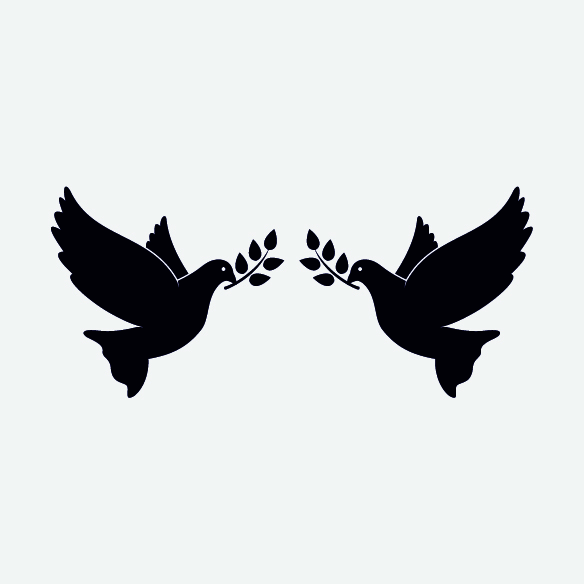Prolog
Und dann kam der blutrünstige Dreckskerl.
Als Kind habe ich mich oft gefragt, ob meine Haut eher braun oder eher weiß aussieht. Mein Haar ist zweifellos schwarz und meine Augen sind braun. Viele Abendländer, denen ich begegnete, dachten wahrscheinlich an den Nahen Osten, wenn sie mich sahen oder meinen Namen hörten – Junis Sultan. „Woher kommst du ursprünglich?“, wurde ich unzählige Male gefragt. Viele waren sichtlich überrascht, dass ich ihre Sprache akzentfrei beherrschte. Die Morgenländer hingegen waren immer wieder enttäuscht und fragten nach, warum ich nicht fließend Arabisch sprach. „Warum haben dir deine Eltern das nicht beigebracht?“ Aus vielerlei Gründen war es für andere Menschen alles andere als einfach, mich in eine Schublade zu stecken – Gleiches galt auch andersherum.
Meine Geschichte ist die ungünstiger Fügungen und der immerwährenden Neuerfindung. Nachdem wir den Golfkrieg überlebt hatten, floh meine Familie im Sommer 1991 aus dem Irak nach Deutschland. Ich war damals vier Jahre alt. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich mit meinem Vater in unserem abgewohnten Wohnzimmer saß und die Nachrichten im Fernsehen verfolgte. Er hob einen Finger und rief: „Der Westen hat dem Irak diese bescheuerten Sanktionen auferlegt, nicht Saddam[1].“ Verschüchtert von seinem Wutausbruch fragte ich leise, was er damit meinte. Er antwortete: „Der Westen, das sind Europa, Nordamerika und Australien. Die haben Millionen von Menschen getötet, und jetzt töten sie uns.“ Damals hatte ich Angst, doch als ich 1992 in den Kindergarten kam, erwies sich die Warnung schon bald als unnötig. Tatsächlich lebten wir jahrelang glücklich und in Frieden mit den Abendländern zusammen.
Seit frühster Kindheit war ich bestrebt, mit allen Menschen um mich herum in Harmonie zu leben, sowohl mit Morgenändern als auch mit Abendländern. Und obwohl ich dabei immer wieder scheiterte, versuchte ich stets, unseren gemeinsamen Wunsch nach Bindung und unser gemeinsames Bedürfnis nach Freiheit gleichermaßen zu achten. Während meiner Pubertät war mir vor allem die Religionsfreiheit wichtig. Die Kluft zwischen uns, die ich insbesondere nach 9/11 spürte, erschien mir oftmals menschengemacht und schädlich für unser Miteinander, und somit war sie auch selbstzerstörerisch und falsch. Während meiner Jugend in Deutschland sinnierte ich oft über den wahren Sinn unserer Existenz. Waren wir nicht alle kostbare soziale Individuen, miteinander verbunden und dazu geschaffen, uns gegenseitig zu tragen, während wir unsere persönlichen Träume zu erfüllen suchen?
Trotz meines festen Glaubens an das Grundbedürfnis des Menschen nach einem echten Miteinander stellte ich unsere Verbundenheit in der Begegnung mit andern Menschen häufig infrage. Viele Abendländer konfrontierten mich mit negativen Stereotypen: „Trägt deine Mutter einen Hijab oder eine Burka?“ „Wurden die Ehen deiner Schwestern arrangiert?“ „Hasst du Juden, Amerika …?“ Nichts davon traf auf mich zu. Ganz im Gegenteil: Meine Mutter ist Christin und hatte selbst Schwierigkeiten, meine andere Religion zu akzeptieren. Doch auch Morgenländer waren oft von mir enttäuscht und sagten: „Trink das nicht! Trag keine kurzen Hosen! Tu dies und das nicht! Das ist haram.[2]“ Nach einer solchen Begegnung fühlte ich mich mehr als einmal seltsam, keiner Gruppe zugehörig und immer wieder herausgefordert. Wie konnte ich unsere Beziehung verbessern und stärken? Oder reagierte ich über? Suchten sie nur Gemeinsamkeiten?
Die jahrtausendealten Geschichten meines Namens haben meine komplexe Identität geformt. 1993, in meinem ersten Schuljahr, erzählte mir mein Vater, dass Junis von Yunus kommt, „einem Propheten im Koran, der fest an Gottes Gesetze glaubte“. Im katholischen Religionsunterricht lernte ich, dass auch die hebräische Bibel und das Neue Testament die Geschichte von Yunus kannten – dort jedoch unter dem Namen Jona. „Jona bedeutet Taube auf Hebräisch, und die Taube ist das Symbol des Friedens“, erklärte meine Lehrerin. Anschließend las sie vor: „Jona erhielt von Gott den Befehl, nach Ninive zu gehen und den Bewohnern ob ihrer Bosheit ein Strafgericht Gottes zu prophezeien. Da Jona jedoch Angst hatte, Gott würde den Sündern einfach vergeben, bestieg er ein Schiff und segelte damit in die entgegengesetzte Richtung; ein folgenschwerer Fehler: Als Gott aufgrund seines Ungehorsams einen Sturm über dem Meer entfachte, machten die Segler Jona dafür verantwortlich und warfen ihn über Bord. Jona wurde von einem Wal verschluckt, tat in dessen Bauch Buße, dankte Gott für seine Gnade und unterwarf sich Gottes Willen. Daraufhin spie der Wal ihn aus.“ Ich starrte meine Lehrerin mit großen Augen an. Zwar hatte ich keine Vorstellung, was das Leben für mich bereithielt und wie ich reagieren würde – manchmal wie ein nachtragender, ungehorsamer Ausreißer –, dennoch konnte ich mich mit Jonas Geschichte identifizieren. Auch ich wollte eine Beziehung zu Gott haben und aufgehoben werden, wenn ich fiel.
Mein Vorname sorgte, wenn ich jemanden kennenlernte, meistens für Konfusionen. Viele Deutsche nannten mich Jonas, nachdem ich mich vorgestellt hatte, selbst wenn ich meinen Namen mit „J U N I S“ buchstabiert hatte. Sprach ich so undeutlich oder ignorierten sie meinen richtigen Namen aus Bequemlichkeit oder gar Respektlosigkeit?, fragte ich mich immer wieder. Manchmal wurde ich gebeten, meinen Namen noch einmal zu buchstabieren, und gefragt, woher der Name kam. Das Problem begann, als ich 1991 eingebürgert wurde. „Die internationale Schreibweise ist Younes, aber das wäre für Deutsche zu kompliziert. Deutsche sind das ‚Y‘ nicht gewohnt, damit gibt es im Deutschen nur sehr wenige Wörter“, erklärte der Beamte damals meiner Mutter. Und so wurde mein Vorname eingedeutscht. Ich selbst war zu jung, um die aufgezwungene Anpassung zu bemerken, doch vielen Morgenländern fiel sie sofort auf. „Bist du überhaupt ein echter Araber?“, fragten sie oft, wenn sie meinen Namen lasen. „Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Iraker“, antwortete ich normalerweise, bevor ich erklärte, warum mein Name eingedeutscht worden war – was oft zu betretenem Schweigen führte. Schon als Kind wurde mir klar, wie sehr mein Name mich definierte.
Mein Nachname, Sultan, amüsierte andere manchmal, denn er erinnerte sie an ein Karnevalslied: „Die Karawane zieht weiter, dä Sultan hät Doosch!“ Manchmal führte er aber auch zu Angst oder einer falschen Idolisierung. Sultan ist ursprünglich das arabische Wort für „Stärke“. Mit der Zeit wurde es darüber hinaus zu einem Titel von Führern, die ihre Unabhängigkeit von höheren Herrschern erklärten. Laut Wikipedia hat einer der berühmtesten Sultane, Mehmed II, 1453 Konstantinopel erobert und damit das Ende des tausendjährigen Byzantinischen Reichs besiegelt. Ich nehme an, seine destruktive Art schüchterte den Westen ein, der – wie Professor Edward Said[3] sagen würde – stets bestrebt war, im direkten Vergleich zum seiner Ansicht nach bösen Orient als gut zu gelten. Merkwürdigerweise schrieb mein Vater dem Nahen Osten die exakt gegensätzlichen Werte zu. Als ob Mehmed II besser als jeder andere Mörder gewesen wäre und als wären die Morde an viertausend Nicht-Muslime im Jahr 1453 gut gewesen. Ich habe nie verstanden, warum manche Leute Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund abwerteten oder gar verteufelten, ihre eigenen Leute jedoch idealisierten. Waren wir nicht alle gleich, einfach nur Menschen mit mehr oder weniger Fehlern, aber alle gleich viel wert, geliebt zu werden?
In meiner Schulzeit in Deutschland von 1993 bis 2006 wurde ich hauptsächlich über die Vorzüge des Westens unterrichtet. Wir nahmen das Zeitalter der Aufklärung in Europa im 17. und 18. Jahrhundert durch. Kants[4] „kategorischer Imperativ“ – „nur nach derjenigen Maxime zu handeln, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ – erschien mir als ein wertvolles Konzept, das Frieden zwischen allen Menschen bringen kann. Wir lasen die Klassiker der deutschen Literaturperioden, von denen mir die Sturm-und-Drang-Zeit des 18. Jahrhunderts am besten gefiel, da sie die freie Äußerung starker Gefühle erlaubte. Aufgeregt studierte ich die Revolutionen für Werte wie Freiheit und Einheit: 1776 in Amerika, 1789 in Frankreich und 1848 in Deutschland.
Vor allem interessierte ich mich für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948, das erste Dokument, das ich in der Schule gelesen habe, das von einem internationalen Komitee entworfen worden war und den Frieden zwischen allen Menschen zum Ziel hatte – ein Traum, von dem ich wünschte, jeder würde ihn teilen.
Während unsere Lehrer behaupteten, die beispiellosen Schrecken des Zweiten Weltkriegs hätten zur AEMR geführt, erfuhr ich 2009 in einem seltenen Seminar über „Postkolonialismus“ an der Goethe-Universität, dass Nazideutschland kein vorübergehender Fehler war, der mehr als siebzig Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Leben kostete, sondern das direkte Ergebnis der propagandistischen und blutigen Geschichte des Westens. Laut Hannah Arendt[5] vermischten sich im 18. und 19. Jahrhundert europäischer Nationalismus und Kolonialismen mit nachaufklärerischen Rassentheorien über die natürliche Überlegenheit der „weißen Rasse“, wodurch schon fast zwei Jahrhunderte vor Hitler der Weg für eine pseudo-legitimierte Versklavung und Tötung nicht-weißer und nicht-christlicher Menschen auf der ganzen Welt geebnet wurde. Unsere Seminardiskussionen offenbarten mir auch, wie seit 1945 aus subtilen, vermeintlich farbenblinden und areligiösen Gründen Millionen von nicht-weißen und nicht-christlichen Menschen weit über die Grenzen des Westens hinaus getötet wurden, und zwar durch wirtschaftliche Ausbeutung, Hunger sowie militärische Interventionen, die Chaos, Zerstörung und sogar Bürgerkriege zur Folge hatten. Doch eine brennende Frage blieb: Wie könnten wir diese Dehumanisierungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beenden?
Das wollte ich unbedingt herausfinden. Nach dem Abschluss meines Grundstudiums an der Goethe-Universität Frankfurt studierte ich von 2010 bis 2011 Politikwissenschaft an der California State University in Fullerton. Während meines Kurses der politischen Philosophie las und lernte ich viel über griechische, hebräische, römische und christliche Gesellschaften, die mein Professor die „Grunderzählungen des Westens“ nannte. Insbesondere gefielen mir die wiederholten Diskussionen darüber, ob es Wahrheiten über Ethik – das richtige individuelle Verhalten – und Politik – das richtige gemeinsame Leben – überhaupt gab. Wie eine Handvoll meiner Kommilitonen war ich dieser Ansicht.
Am Ende des Semesters stellte mein Professor die Theorie auf, dass der moderne, globale Liberalismus des 21. Jahrhunderts eine Synthese aus allen Geschichten des Westens darstellt. Da ich seine eurozentrische Perspektive mit Skepsis betrachtete, fragte ich ihn nach der Rolle des Rests der Welt. Er zögerte eine Sekunde, bevor er den Kopf hob, eine Augenbraue hochzog und antwortete: „Nun ja, da waren Mesopotamien, Ägypten, Persien und dann kam der blutrünstige Dreckskerl Mohammed, der den Islam mit dem Schwert verbreitete.“ Ich saß in der letzten Reihe und schaute ihn ungläubig an. Hatte er das gerade wirklich gesagt? Als ob die Geschichten des Westens frei von Blutvergießen wären. Ich schwieg und erwartete, mehr über sein schwarz-weißes Weltbild zu hören, doch er unterbrach sich selbst. „O Scheiße, ist sie hier? Die mit dem Kopftuch?“, fragte er und sah sich um.
Ihr Name war Manar, „Leitlicht“ auf Arabisch. An dem Tag war sie nicht im Kurs, ich jedoch schon – und verkörperte eine Mischung aus jüdischen, christlichen, muslimischen, deutschen, arabischen und osmanischen Traditionen. Wie schon so oft zuvor fragte ich mich auch an diesem Tag: Wie könnten wir die feindselige Haltung gegenüber anderen überwinden? Wie könnten wir aufeinander zugehen und uns gegenseitig schätzen? Wie könnten wir mehr Freude und Frieden untereinander und in uns selbst schaffen?
[1] Saddam Hussein (28. April 1937–30. Dezember 2006), fünfter Präsident des Iraks, Amtszeit vom 16. Juli 1979 bis zum 9. April 2003.
[2] Arabisch, bedeutet „verboten“ oder „geächtet“ nach islamischen Gesetzen.
[3] Edward Wadie Said (1. November 1935–25. September 2003), Professor für Literatur, Intellektueller und Begründer des akademischen Fachs der Postkolonialen Studien.
[4] Immanuel Kant (22. April 1724–12. Februar 1804), deutscher Philosoph, der als zentrale Figur der modernen Philosophie gilt und für sein Buch Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bekannt ist.
[5] Johanna „Hannah“ Arendt (14. Oktober 1906–4. Dezember 1975), in Deutschland geborene Jüdin, Amerikanerin und politische Theoretikerin.